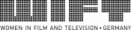Gegenwartskino im Fokus
Wichtige Stimmen des gegenwartskinos
FILMFEST HAMBURG beleuchtet seit 2019 im Format »Gegenwartskino im Fokus« jährlich die Arbeiten von jeweils zwei der derzeit spannendsten Stimmen des Weltkinos, die in Deutschland noch weniger bekannt sind. Die Filmemacher·innen – jeweils ein Mann und eine Frau, die idealerweise von zwei Kontinenten kommen – waren eingeladen, in ausführlichen Gesprächen ihre Filme und Arbeitsweisen vorzustellen. Neben den aktuellsten Titeln haben Werkschauen mit früheren Filmen das Programm vervollständigt.
2023
Alice Rohwacher (Italien), Bertrand Bonello (Frankreich)
2022
Ruth Mader (Österreich), Santiago Mitre (Argentinien)
2021
Andrea Arnold (UK), Sean Baker (USA)
2020
Kelly Reichardt (USA), Pablo Larraín (Chile)
2019
Céline Sciamma (Frankreich), Lav Diaz (Philippinen)